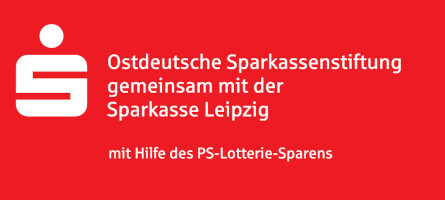Rückblick
Hier erhalten Sie einen Überblick über die vergangenen Ausstellungen.
Sonderausstellung 24. Mai bis 15. Dezember 2024
Der Name Bach ist in aller Welt mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach verbunden. Doch was ist über die Frauen der berühmten Musikerfamilie bekannt?
Die Ausstellung beleuchtete ihre Biografien und Handlungsspielräume über einen Zeitraum von 200 Jahren. An Hörstationen erhoben die Frauen der Familie Bach selbst ihre Stimme und berichteten aus ihrem Leben.
Zu einigen Frauen wie Bachs Enkelin Anna Carolina Philippina Bach gibt es verhältnismäßig viele Quellen. Sie wirkte aktiv im Musikalienhandel ihres Vaters Carl Philipp Emanuel Bach mit und führte diesen nach dem Tod ihrer Eltern als selbständige Geschäftsfrau fort. Über ihre Tätigkeit gibt unter anderem ihre Geschäftskorrespondenz mit dem Musikaliensammler und Organisten Johann Jacob Heinrich Westphal Auskunft – ein Konvolut von 37 Briefen, welches das Bach-Archiv im Jahr 2017 erwerben konnte. Anna Carolina Philippina Bach ist zudem eine der wenigen Frauen aus der Bach-Familie, von deren Aussehen wir eine Vorstellung haben..
Von Cecilia Bach – einer von vier professionellen Sängerinnen der Bach-Familie – hat sich dagegen nur eine einzige handschriftliche Unterschrift erhalten: 1783 gab sie die Oper „Amadis de Gaule“ ihres verstorbenen Mannes Johann Christian Bach heraus – ein Werk, das bei der Uraufführung 1779 in Paris gegen den Willen des Komponisten künstlerisch verändert worden war. Cecilia nutzte das Vorwort des von ihr verantworteten Erstdrucks, um für die Rechte ihres verstorbenen Mannes einzutreten. Mit Nachdruck wies sie auf die ursprüngliche Fassung des verstümmelt aufgeführten Werkes hin.
Die Ausstellung entlockte den Quellen und Dokumenten auf vielfältige Weise ihre Geschichten und vermittelte diese auf leicht verständliche Weise. Anhand von Dokumenten, Musikalien, Bild- und Sachzeugnissen sowie Hörstationen und interaktiven Elementen wurden die bislang verborgenen Lebensbilder der Frauen anschaulich.
Sonderausstellung in 3 Akten zum 300-jährigen Jubiläum von Bachs Amtsantritt in Leipzig
1723 begann ein neues Kapitel der Musikgeschichte: Johann Sebastian Bach wurde zum Thomaskantor in Leipzig gewählt. In 27 Jahren schuf er ein einzigartiges Werk, das heute zum Weltkulturerbe der Menschheit gehört. Vom Thomaskirchhof aus traten seine Werke ihren Siegeszug rund um dem Globus an. Doch was ist eigentlich das Geheimnis von Bachs Musik? Worin zeigt sich ihre besondere Qualität und Innovation? Und warum war sein Wechsel nach Leipzig für sein kompositorisches Schaffen so maßgeblich?
Die Jubiläumsausstellung widmete sich diesen Fragen und lud dazu ein, tief in Bachs musikalischen Kosmos einzutauchen. In drei Akten bereitete sie seiner unerschöpflichen Kunst eine Bühne – zum Sehen, Hören und spielerischen Entdecken.
1. Akt: Kirchenmusik zu Ehren Gottes, 21. März 2023 bis 9. Juli 2023
2. Akt: Auf der Suche nach Vollkommenheit, 22. Juli 2023 bis 5. November 2023
3. Akt: Bachs Musik wird zum Modell, 16. November 2023 bis 24. März 2024
Wir danken unseren Förderern
Zur Ausstellung ist ein Online-Katalog erschienen, den Sie hier einsehen können.
Sonderausstellung aus Anlass des 350. Todestages von Heinrich Schütz vom 6. Mai bis 3. Oktober 2022
Die Meisterwerke von Heinrich Schütz (1585–1672) und Johann Sebastian Bach (1685–1750) gelten Musikliebhabern weltweit als Inbegriff lutherischer Kirchenmusik. Hundert Jahre vor Bach geboren, schuf Heinrich Schütz ergreifende Kompositionen unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648). Sein Lebensweg führte den Dresdner Hofkapellmeister bis nach Dänemark und Italien. Die bahnbrechenden musikalischen Entwicklungen Oberitaliens übertrug Schütz auf Texte der Lutherbibel und bewirkte somit eine tiefgreifende Erneuerung der Musik im deutschsprachigen Raum. Von den Zeitgenossen wurde Schütz parens nostrae musicae modernae – Vater unserer modernen Musik genannt. Mit seinem Wirken prägte er das Schaffen mehrerer Komponistengenerationen.
Großen Einfluss übte Schütz auf die Musik der Leipziger Thomaskantoren aus. Sie zählten zu den führenden Komponisten ihrer Zeit, trugen maßgeblich zur Entwicklung der Kirchenkantate bei und legten so die Grundlagen für das faszinierende Kantatenwerk von Johann Sebastian Bach, dessen überwältigende Kompositionskunst fest im fruchtbaren musikalischen Boden des 17. Jahrhunderts wurzelt. Als Thomaskantor führte Bach ausgewählte Stücke seiner Amtsvorgänger auf. Was wusste er über Heinrich Schütz und dessen Werke? Die Ausstellung aus Anlass des 350. Todestages von Heinrich Schütz führte tief in die musikalischen Welten der Leipziger Thomaskantoren von Sethus Calvisius bis Johann Kuhnau und spürte den vielfältigen Verbindungslinien von Schütz zu Bach nach.
30. April 2021 bis 9. Januar 2022
Der Leipziger Maler Michael Triegel (geb. 1968) erschafft im Rückgriff auf die Kunst vergangener Epochen Bilder von hoher Aktualität. Die Werke des Barockkomponisten Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) sind höchst gegenwärtig und ziehen Menschen weltweit in ihren Bann. Beide Künstler widmen sich in ihren spezifischen Kunstgattungen grundlegenden Themen menschlichen Seins wie Glaube und Zweifel, Leben und Tod, Schönheit und Vergänglichkeit.
In der Ausstellung des Bach-Museums Leipzig traten 33 Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken Michael Triegels in einen Dialog mit Kompositionen Johann Sebastian Bachs. Malerei und Musik, Farbtöne und Klangfarben, bildkünstlerische und musikalische Sprache öffneten Assoziationsräume für das Verständnis der verhandelten Sujets. Originale Notenhandschriften, Bibeln, Textdrucke und andere Werke aus Bachs Bibliothek gewährten darüber hinaus Einblicke in die barocken Kompositionen und ihre Quellen.
Wir danken Michael Triegel, der Galerie Schwind Leipzig und allen Leihgebern für die großzügige Unterstützung.
14. Mai bis 3. August 2020
Kabinettausstellung zum 250. geburtstag Ludwig van Beethovens
Heute gehören Beethoven und Bach zu den bekanntesten Komponisten weltweit. Doch wie kam es dazu, dass gerade diese Komponisten und ihre Werke zu »Klassikern« wurden? Entscheidende Voraussetzungen gingen von einer Leipziger Musikzeitschrift aus: der 1798 gegründeten Allgemeine musikalischen Zeitung (AMZ). Beethovens Musik galt seinen Zeitgenossen zunächst als unverständlich, radikal und verstörend. Die AMZ vermittelte ihren Lesern im gesamten deutschsprachigen Raum tiefe Einblicke in Beethovens Schaffen und förderte das Verständnis seiner Musik. Verschiedene Abhandlungen deuteten die von der Oper dominierte Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts als eine Geschichte der Instrumentalmusik um, mit Bach als Anfang und Beethoven als Ziel. Erstmals etablierte sich ein »Kanon der klassischen Meisterwerke«, in dem auch Haydn und Mozart ihren Platz fanden.
Die Ausstellung veranschaulichte die Kanonisierung von Bach und Beethoven als Klassiker der Musik am Beispiel der Musikstadt Leipzig im frühen 19. Jahrhundert. Sie machte zudem den Einfluss von Bachs Musik in Beethovens Kompositionen erlebbar. Autographe Briefe und Notenhandschriften Ludwig van Beethovens sowie der Originalvertrag mit dem Verlag Breitkopf & Härtel dokumentieren Beethovens Beziehungen zu Leipzig und dem Schaffen des berühmten Thomaskantors. Frühe Notenausgaben Bachs und Beethovens, Zeitschriften, Konzertprogramme des Gewandhauses, Prüfungsprotokolle des Konservatoriums, Grafiken und Porträts sowie ein Pianino von 1837 beleuchteten das reiche Musikleben im Leipziger Bürgertum. Zahlreiche Hörbeispiele brachten Musik und Geschichten zum Klingen.
23. August 2019 bis 19. Januar 2020
Der 200. Geburtstag von Clara Schumann bot den willkommenen Anlass, drei Musikerinnen in den Blick zu nehmen, die bekannte Namen tragen und in Forschung und Öffentlichkeit auf wachsendes Interesse stoßen: die Hofsängerin Anna Magdalena Bach geb. Wilcke (1701–1760) sowie die Pianistinnen und Komponistinnen Fanny Hensel geb. Mendelssohn (1805–1847) und Clara Schumann geb. Wieck (1819–1896). Ihre Lebensdaten umfassen zwei Jahrhunderte, in denen sich die Handlungsspielräume und Tätigkeitsfelder von Musikerinnen wandelten und erweiterten.
Die Ausstellung beleuchtete ihr vielseitiges Wirken als Interpretinnen, Komponistinnen, Konzertorganisatorinnen, Herausgeberinnen und Musikalienhändlerinnen. Familienbande und gesellschaftliches Umfeld werden gestreift. Der Komponist Johann Sebastian Bach war für alle drei Frauen ein wichtiger Bezugspunkt. Ihre Beschäftigung mit seiner Musik zog sich als roter Faden durch die Ausstellung. Zu sehen waren kostbare Originale wie das bekannte Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, der Lobgesang von Fanny Hensel, Fugenstudien von Clara Schumann und der erste Band des Ehetagebuchs von Clara und Robert Schumann. Zahlreiche Hörstationen brachten die Kompositionen, Konzertprogramme sowie Briefe und Tagebuchausschnitte zum Klingen und luden dazu ein, tief in die Welt der Musikerinnen einzutauchen.
15. Februar bis 23. Juni 2019
Auf gute Beziehungen zu Fürsten legte Johann Sebastian Bach höchsten Wert. Ein Drittel seines Berufslebens stand er in fürstlichen Diensten ‒ als Hoforganist und Konzertmeister in Weimar (1708–1717) sowie als Kapellmeister in Köthen (1717–1723). Auch als Leipziger Thomaskantor erhielt er höfische Ehrentitel: 1729 wurde er zum Sachsen-Weißenfelsischen Hofkapellmeister ernannt, 1736 verlieh ihm der Dresdner Hof den Titel „Hof-Compositeur“. In Bachs Biografie spiegelt sich die einzigartige Dichte kleiner Residenzen in Mitteldeutschland. Politisch meist unbedeutend, entfalteten sie Glanz und Pracht auf dem Gebiet der Kultur. Bekannte Werke wie die Brandenburgischen Konzerte, die Jagdkantate oder das Orgelbüchlein zeugen von Bachs innovativen und virtuosen Kompositionen für Höfe. Doch wie verlief eine fürstliche Festmusik eigentlich?
Wer waren Bachs Auftraggeber und welche Pflichten hatte er zu erfüllen? Die interaktive und klingende Ausstellung stellte Bachs Kompositionen in den Kontext des höfischen Lebens voller Regeln und Zeremonien. Zu den kostbarsten Exponaten gehörten originale Bach-Handschriften der Brandenburgischen Konzerte, der Messe in h-Moll und der erst 2005 vom Bach-Archiv entdeckten Arie „Alles mit Gott und nichts ohn‘ ihn“. Eine Fürstengalerie, Tafelgegenstände und Schriften wie das „Mandat wider das unbefugte Trompeten-Blasen“ führten in die Welt des Hofes ein. Zahlreiche Hörstationen brachten seine Musik zum Klingen. Eine Medienstation lud dazu ein, in Bachs Notenhandschriften zu blättern, seine Aufführungsorte in Weimar und Köthen näher kennenzulernen oder ein amüsantes Quiz zu lösen.
Video zur Ausstellung: https://www.youtube.com/watch?v=u7vDD4NQp-c
20. April bis 23. September 2018
Johann Sebastian Bach war ein gefragter Lehrer. Zeit seines Lebens unterrichtete er talentierte junge Musiker in Klavier-, Orgelspiel und Komposition. Da Bach seine Schüler oft in seiner Wohnung beherbergte, gewannen sie tiefe Einblicke in den Alltag des Komponisten. Was können sie uns über ihren Lehrer berichten? Auf der Suche nach bislang unbekannten Bach Dokumenten durchforsten Wissenschaftler/innen des Bach-Archivs seit 2002 historische Archive und Bibliotheken in ganz Deutschland. Ein von der Fritz Thyssen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt spürte den über 100 Privatschülern Bachs nach. Ihre Lebensläufe, Briefe, Bewerbungen und Zeugnisse geben Aufschluss über Bachs Unterrichtspraxis und bieten neue Erkenntnisse zu seinem Leben und Werk. Die Ausstellung gab Einblicke in die spannendsten Quellenfunde des Forschungsprojekts und stellte Wege und Methoden der Wissenschaftler/innen vor. Exemplarisch folgte sie den Spuren der Schüler und führte unter anderem nach Augsburg, wo Philipp David Kräuter das Musikleben der freien Reichsstadt prägte. Bachs Unterrichtsmethoden konnten Besucher an einer interaktiven Station nachvollziehen und dabei ein Clavichord selbst ausprobieren. Zahlreiche Klangbeispiele ließen die Kompositionen der Schüler mit denen ihres großen Lehrmeisters vergleichen. Doch was haben eine mathematische Abhandlung und ein Messinstrument aus der Schifffahrt mit Bachs Kreuzstabkantate zu tun? Diese und andere Fragen beantwortete die Ausstellung und nahm die Besucher auf eine faszinierende Entdeckungsreise mit.
8. September 2017 bis 28. Januar 2018
Musik war für Martin Luther eine „herrliche Gabe Gottes“, die gleich nach der Theologie rangierte und gleichermaßen dazu geeignet war, Gott zu loben, sein Wort zu verkünden, den Menschen Trost zu spenden und zu ihrer Charakterbildung beizutragen. Zusammen mit seiner wortmächtigen Bibelübersetzung gehört das muttersprachliche Kirchenlied zu den einflussreichsten Botschaftern der Reformation. Luthers eigene Kirchenlieddichtungen und -vertonungen wurden zum prägenden Bestandteil protestantischer Kirchenmusik.
Kaum ein Komponist steht so für lutherische Kirchenmusik wie Johann Sebastian Bach. Seine von Bibel und Gesangbuch inspirierten Kompositionen gelten heutigen Hörern weltweit als deren Inbegriff. In der Ausstellung steht Bachs Leipziger Choralkantaten-Jahrgang im Mittelpunkt, einer seiner wichtigsten Beiträge zur Vokalmusik. Zu den kostbarsten Exponaten gehören die autographe Partitur der Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort“ BWV 20 sowie zahlreiche originale Aufführungsstimmen, darunter „Christ lag in Todesbanden“ BWV 4, „Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 62 und „Aus tiefer Not“ BWV 38. Bachs eindrucksvolle Choralbearbeitungen für die Orgel sind mit wertvollen Erstdrucken vertreten. Zahlreiche Hörstationen verwandeln den Ausstellungsraum in ein Hörkabinett. Eine prachtvolle Luther-Bibel, in die Bach seinen Namen eingetragen hat, gibt neben anderen imposanten theologischen Büchern Einblick in seine Bibliothek. Weitere Exponate beleuchten biographische Parallelen zwischen Bach und Luther oder berichten von Reformationsfeiern zu Bachs Zeit.
27. Januar bis 25. Juni 2017
Seit Einführung der Reformation in Leipzig 1539 bildete die evangelisch-lutherische Konfession die Basis für das religiöse und soziale Zusammenleben. In die pulsierende Handelsmetropole kamen jedoch – besonders zu den drei jährlichen Messen – Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus mit unterschiedlichen Konfessionen und Religionen. Die Stadt und die evangelisch-lutherische Kirchenbehörde wachten streng über »unliebsame« Glaubensausübungen. Dennoch begann um 1700 unter der Regierung des sächsischen Kurfürsten August des Starken – nicht zuletzt aus machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen – eine Lockerung der bis dahin weitgehend religiösen Einheitlichkeit.
Die Kabinettausstellung beleuchtete die religiöse Situation in Leipzig zur Bach-Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Neben der vorherrschenden evangelisch-lutherischen Kirche gab es seit 1701 eine evangelisch-reformierte und seit 1710 eine katholische Gemeinde, 1743 kam eine griechisch-orthodoxe hinzu. Jüdische Händler durften nur eingeschränkt während der Handelsmessen ihre Religion ausüben. Ein weiteres Kapitel geht der Frage nach, inwieweit der evangelisch-lutherische Thomaskantor Johann Sebastian Bach mit anderen Konfessionen in Berührung kam. Zu den wertvollsten Ausstellungsstücken gehörten Stimmen aus der Missa h-Moll BWV 232 (Kyrie und Gloria der späteren h-Moll-Messe), die Bach dem katholischen Kurfürsten widmete.
4. März bis 23. Oktober 2016
»Es gibt nichts so Kompliziertes in unserer modernen Harmonik, was nicht der alte Bach längst vorweg genommen hätte«, resümierte einmal Max Reger in tiefer Verehrung für den großen Thomaskantor. Für Reger waren die »Geheimnisse der Harmonie« in Bachs Werken ebenso faszinierend wie dessen Fugentechnik, die er als Basis allen Komponierens verstand: »Sebastian Bach ist für mich Anfang und Ende aller Musik; auf ihm ruht und fußt jeder wahre Fortschritt« – mit diesem Bekenntnis setzte er sich als Komponist, Bearbeiter und Dirigent intensiv mit dem Schaffen Bachs auseinander. Bach und Reger – zwei Komponisten, die ihrer Zeit in vielerlei Hinsicht weit voraus waren, stehen nicht nur im Zentrum des Bachfestes 2016, sondern auch im Mittelpunkt einer Kabinettausstellung, die das Bach-Museum Leipzig anlässlich des 100. Todestages von Reger gemeinsam mit dem Max-Reger-Institut Karlsruhe veranstaltete. Ausgestellt waren u.a. kostbare Autographen, Erstdrucke, Briefe, Konzertprogramme und Fotografien aus der Sammlung des Max-Reger-Instituts.
8. Mai bis 11. Oktober 2015
Anlässlich des Stadtjubiläums »1000 Jahre Leipzig« nahm das Bach-Museum ausgewählte Frauen in den Blick, die zur Zeit Bachs hier gelebt haben. Die Ausstellung beleuchtete, welche wichtige Rolle Frauen im Kultur- und Wirtschaftsleben des barocken Leipzig spielten. Beleuchtet wurden Lebensschicksale und Wirkungsbereiche berühmter Frauen, wie der Dichterin Christiane Mariane von Ziegler, die nicht nur einen literarisch-musikalischen Salon führte, sondern auch Kantatentexte für Bach verfasste. Noch populärer war die Schauspielerin und Theaterprinzipalin Friederica Carolina Neuber, die in Leipzig große Erfolge feierte, zuletzt jedoch bittere Not erlitt. Aber auch unbekanntere Frauen werden bedacht, beispielsweise Witwen, die mit großzügigen Stiftungen öffentliche Einrichtungen und Bedürftige unterstützten. Nicht fehlen dürfen die Kantorenfrauen Anna Magdalena Bach und ihre Vorgängerinnen. Zu den ausgestellten Exponaten zählten Handschriften, Grafiken sowie Dokumente, die über das Wirken und die Lebenssituationen der Frauen Aufschluss geben.
26. September 2014 bis 15. Februar 2015
Während seiner Zeit als Thomaskantor übernahm Johann Sebastian Bach stets auch musikalische Aufgaben an der Universität. Dazu gehörten die Kirchenmusik an hohen Feiertagen sowie die musikalische Gestaltung der vierteljährlichen Redeakte in der Universitätskirche. Außerdem gingen an Bach Auftragswerke für besondere Anlässe. Zu den eindrucksvollsten gehören die Trauerode »Laß Fürstin, laß noch einen Strahl« für die verstorbene Kurfürstin Christiane Eberhardine und die Motette »Der Geist hilft unser Schwachheit auf« zur Beerdigung des Thomasschulrektors Johann Heinrich Ernesti. Weitere Anlässe für Kompositionen boten Jubiläen von Professoren oder Huldigungen für die kurfürstliche Familie, zu denen oftmals opulente Freiluftmusiken, verbunden mit prächtigen Zeremonien, stattfanden. Darüber hinaus begeisterten Bach und sein Studentenorchester mit anspruchsvollen, auch kurzweiligen und amüsanten Programmen zahlreiche Besucher im Zimmermannschen Kaffeehaus oder Kaffeegarten.
Die Ausstellung zeigte originale Bach-Handschriften, Beschreibungen der Spielstätten und andere Dokumente sowie Grafiken, die das reiche Musikleben im Umfeld der Leipziger Universität anschaulich machten.
Die Ausstellung wurde gefördert vom Packard Humanities Institute (Los Altos, California) und von der Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs Leipzig e.V.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.
7. März bis 20. Juli 2014
Carl Philipp Emanuel Bach war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannter als sein heute weltberühmter Vater Johann Sebastian. Am 8. März 1714 in Weimar geboren, ließ er die barocke Klangwelt seiner Jugend bald hinter sich und vertrat ein neues Lebensgefühl mit individuelleren Ausdrucksformen. Er wurde zum bedeutendsten Komponisten der Epoche der Empfindsamkeit und war ein geschätztes Vorbild für Komponisten wie Mozart oder Haydn.
Aus seiner frühen Schaffensphase in Leipzig und Frankfurt an der Oder, wo er erste wichtige musikalische Erfahrungen sammelte, sind nur wenige Kompositionen erhalten. C. P. E. Bach selbst vernichtete später viele seiner Frühwerke. In der Ausstellung wurden jedoch einige seiner frühesten erhaltenen Handschriften gezeigt, so eine erst 2010 in Mügeln (ca. 60 km östlich von Leipzig) entdeckte Kantate oder ein Schulheft des 13-jährigen Thomasschülers. Außerdem wurde sichtbar, dass sich Carl Philipp Emanuel intensiv mit dem Werk seines Vaters auseinandersetzte, aber dennoch ganz eigene Wege ging. Ab 1738 war er drei Jahrzehnte lang Cembalist bei Friedrich II. in Berlin/ Potsdam. Exponate aus dieser Zeit sind beispielsweise Kompositionen für Cembalo und sein erstes großes Vokalwerk, das Magnificat. Europäische Berühmtheit erlangte Bach während seiner Zeit als Musikdirektor in Hamburg, unter anderem mit dem großen Chorwerk »Heilig« und zahlreichen Klavier-Sonaten. Briefe und Stammbucheinträge zeugen von vielfältigen Kontakten und Freundschaften mit Künstlern, Intellektuellen und Geschäftspartnern. Nach dem Urteil eines ehemaligen Kommilitonen habe sich Bach »durch Natürlichkeit, Tiefe und Nachdenklichkeit« ausgezeichnet und »sei trotzdem ein lustiger Gesellschafter gewesen« (J. v. Stählin, 1784).
19. September 2013 bis 9. Februar 2014
Im Bach-Archiv Leipzig befindet sich die größte private Tastenmusik-Sammlung aus dem 18. Jahrhundert. Mehr als 250 Werke J. S. Bachs sind darin enthalten. Hinzu kommen 70 Stücke von Carl Philipp Emanuel Bach sowie Werke anderer Komponisten. Diese einzigartige Sammlung des Nürnberger Organisten Leonard Scholz (1720–98) wurde erstmals öffentlich präsentiert.
Aber wer war Scholz? Warum erstellte er von Bachs Kompositionen so ungewöhnliche Arrangements und woher kannte er so viele Werke Bachs? Die Ausstellung führte in die Besonderheiten der Sammlung ein und gab Einblicke in die Lebenswelt des Nürnberger Organisten und wohlhabenden Spezereienhändlers. So reagierte Scholz mit seinen Bearbeitungen vermutlich auf die stark eingeschränkten Spielmöglichkeiten der Nürnberger Orgeln. Ratsakten wiederum berichten, dass der angesehene Bürger Scholz seine Ehefrau und Tochter wegen Unzuchts in einen Gefängnisturm sperren ließ. Die Probleme zogen sich über Jahre hin. Vielleicht war das häusliche Unglück einer der Gründe für seine unbändige Sammelleidenschaft? Diese umfasste viele weitere Bereiche, z.B. Musikinstrumente. In der Ausstellung war u.a. ein Nürnberger Geigenwerk zu sehen, ein ungewöhnliches Tasteninstrument, bei dem mittels der Klaviatur und einer Anzahl von Rädern Saiten angestrichen werden.
Die Ausstellung wurde gefördert vom Packard Humanities Institute (Los Altos, California) und der Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs Leipzig e.V.
15. März bis 25. August 2013
Der Vorhang der Leipziger Oper öffnete sich erstmals im Mai 1693. Endlich wurde die Oper eine feste Größe im Musikleben der Messestadt. Gäste aus ganz Europa, darunter Fürsten, Adelige und viele Handelsleute, besuchten das erste bürgerliche Musiktheater in Mitteldeutschland. Bekannte Komponisten wie Georg Philipp Telemann oder Johann David Heinichen führten hier ihre Opern auf. Nach Berichten von Zeitgenossen stand die Leipziger Oper der berühmten Hamburger Gänsemarktoper in nichts nach. Diese Opernherrlichkeit dauerte allerdings nur bis 1720, denn Liebe, Macht und Leidenschaft bestimmten die Inhalte nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben der konkurrierenden Veranstalter. Sie raubten sich gegenseitig die Kostüme oder zerstörten gar die Bühne. Dass trotz solch widriger Umstände und drückender Schuldenberge Oper vom Feinstern gespielt werden konnte, lässt sich nur mit der Begeisterung und Hingabe der Mitwirkenden erklären.
Die Ausstellung wurde gefördert durch die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, das Packard Humanities Institute (Los Altos, California) und die Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs Leipzig e.V.
21. September 2012 bis 27. Januar 2013
Zum 800. Geburtstag des Thomanerchores zeigte das Bach-Museum Leipzig die Kabinettausstellung »Die Träume des Herrn Bach«. Präsentiert wurden Zeichnungen, Wimmelbilder und ein kurzer Trickfilm des Illustrators, Grafikers und Trickfilmzeichners André Martini. Mit dem Medium der Illustration und des Zeichentrickfilms unternahm die Ausstellung eine spannende und kuriose Reise in das barocke Leipzig. Das von widrigen Bedingungen und Alltagsproblemen belastete Leben Bachs und seiner Chorknaben wurde auf humorvolle, spannende und oftmals kuriose Weise erzählt. Die verblüffenden Geschichten und unterhaltenden Begebenheiten, die mit Hilfe des Zeichenstiftes vorgestellt wurden, beruhen dabei auf gut recherchierter historischer Basis.
André Martini wurde in Dresden geboren. Er studierte an der Burg Giebichenstein in Halle und illustrierte u. a. Kinderbücher für den Klett Kinderbuchverlag, Leipzig, und den Verlag Kamprad, Altenburg. Seit 2009 arbeitet er an einem Projekt über Johann Sebastian Bach. Drehbuch und Konzept entwickelte er mit Hilfe eines Stipendiums der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.
Die Ausstellung wurde gefördert durch die Vereinigung der Freunde des Bach-Archivs Leipzig.
9. Mai bis 29. Juli 2012
Bachs Nachlassverzeichnis nennt 52 theologische Werke in 81 Bänden aus der Bibliothek des Komponisten. Darunter befindet sich auch eine von Abraham Calov herausgegebene und kommentierte Lutherbibel. Dieses imposante, dreibändige Werk, das sich heute im Besitz des Concordia Seminary, St. Louis, Missouri USA befindet, ist eines der ganz wenigen bekannten Handexemplare Bachs. Zahlreiche handschriftliche Eintragungen zeugen von seinem Studium der Bibel. Zwei Bände dieses Werkes waren in der Ausstellung zu sehen. Zusammen mit einer illustrierten Merianbibel aus dem Jahr 1704, die erst kurz zuvor als Handexemplar Bachs identifiziert wurde, bildeten sie das Herzstück der Kabinettaustellung. Umrahmt wurden diese äußerst seltenen Bücher aus Bachs eigener Bibliothek von Parallelexemplaren anderer Bibeln und Gesangbücher, also von Büchern, die Bach nachweislich besessen hat, von denen sein eigenes Exemplar allerdings verschollen ist. Weitere Exponate gaben einen Einblick in die liturgische Welt am protestantischen Thomaskantorat. Wichtige Kompositionen Bachs, etwa die Motette »Jesu, meine Freude« oder die Choralkantaten lieferten zudem ein musikalisches Zeugnis seiner umfassenden Auseinandersetzung mit Bibel und Gesangbuch.
Mit freundlicher Unterstützung von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, »Luther 2017« und AON.
16. März bis 22. Juli 2012
Der 800. Geburtstag des Thomanerchores stand im Jahr 2012 im Zentrum des musikalischen Lebens der Stadt Leipzig. Als einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands verfügt er über eine weltweite Anziehungskraft und eine faszinierende Geschichte.
Das Bach-Museum Leipzig beleuchtete in seiner Ausstellung »Netzwerk Thomanerchor« das Leben der Chorsänger und ihres berühmtesten Kantors, Johann Sebastian Bach. Zahlreiche Quellen aus dem 18. Jahrhundert zeugen vom Leben der Thomaner, die zwischen vielen Verpflichtungen und einem streng geordneten Tagesablauf eine herausragende musikalische Ausbildung erhielten. Von den insgesamt 150 Schülern Thomasschülern gehörten 55 dem Thomanerchor an, und nur diese wohnten auch in der Thomasschule. Sie sangen in den Stadtkirchen, bei Beerdigungen, Hochzeiten und anderen Anlässen, probten für ihre Auftritte, erlernten Musikinstrumente und hatten ihr Schulpensum zu absolvieren. Besucher der Ausstellung erhielten Einblicke, wie es möglich war, alle diese Herausforderungen zu bewältigen. Neben Exponaten, die vom musikalischen Leben zeugen, erfuhren die Besucher der Ausstellung auch Alltägliches, beispielsweise was auf dem Speiseplan der Thomaner stand. Thematisiert wurden auch Unzulänglichkeiten, Konflikte und Ereignisse, die Bach »in Rage« brachten. Außerdem wurde die berufliche Entwicklung ehemaliger Thomaner weiter verfolgt. Denn viele von ihnen profitierten nicht nur von der exzellenten Ausbildung, sondern auch von Bachs weitreichenden Kontakten und seinem Einfluss bei der Vergabe von Universitätsstipendien, Organisten- und Kantorenstellen. So wurden bedeutende kirchenmusikalische Ämter in Mitteldeutschland und darüber hinaus von Bach-Schülern besetzt. Das Leipziger Thomaskantorat hatte unter Bach eine solche Anziehungskraft, dass er zudem viele private, oft schon sehr erfahrene Schüler unterrichtete. Diese wirkten bei Bedarf zudem im Orchester oder im Chor mit. Das Funktionieren des »Netzwerkes Thomanerchor« basierte dabei sowohl auf musikalischer Spitzenklasse, als auch auf den persönlichen Kontakten, der Kreativität und dem Organisationstalent des Thomaskantors.
Mit freundlicher Unterstützung von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und »Luther 2017«
2. September bis 1. Dezember 2011
Carl Philipp Emanuel Bach, einer der geschätztesten Musiker seiner Zeit, legte im Lauf seines Lebens eine bedeutende Sammlung von Musikerporträts an. Die Sammlung, die etwa 400 Bildnisse enthielt, gewährt einen einzigartigen Einblick in seine Kenntnis der Musik- und Kulturgeschichte. Die Bandbreite der Dargestellten ist enorm. Sie reicht von zeitgenössischen Komponisten, Virtuosen und Sängern über Musiktheoretiker, Wissenschaftler und Philosophen bis hin zu Figuren der Musikgeschichte und Mythologie. Mitglieder der Familie Bach sind ebenso vertreten wie eigene Freunde und Kollegen. Die Sammlung hatte eine hohe Ausstrahlung auf die Zeitgenossen. Als erste Sammlung von Musikerporträts in Deutschland wurde sie besonders geschätzt und inspirierte andere Musikliebhaber, eigene Kollektionen aufzubauen. Lange Zeit galt die Sammlung als verschollen. Im Rahmen der C. P. E. Bach Gesamtausgabe wurde sie rekonstruiert. Erstmals waren wesentliche Bestandteile in einer Ausstellung zu sehen.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.
15. April bis 31. Juli 2011
Ein Haus kennt viele Leben, besonders das Bosehaus, das vor 300 Jahren entstand und zu den schönsten Bürgerhäusern Leipzigs gehört. 1711 bezog Georg Heinrich Bose – ein wohlhabender Kaufmann, Besitzer einer Gold- und Silberwarenmanufaktur und später Nachbar von J. S. Bach – das Haus. Die komfortable barocke Hausanlage ist heute Sitz des Bach-Archivs Leipzig mit dem Bach-Museum. Mehrfach wurde das in unmittelbarer Nähe der Thomaskirche gelegene Haus im Laufe der Jahrhunderte baulich verändert – ein Aspekt, der auch in der Ausstellung eine Rolle spielte. Im Vordergrund der Präsentation stand jedoch das Leben im Hause. Welche Menschen lebten hier, welchen Lebensstil bevorzugten sie, was war ihnen wichtig? Zu sehen waren Streiflichter aus dem Alltag von kunstsinnigen Bürgern, Kaufleuten und Sammlern von Gemälden sowie Musikinstrumenten. Außerdem gab es hier mehrere Verlage, Gaststätten und Spielbetriebe der leichten Muse. Einbezogen wurde auch ein Blick in die Frühgeschichte des Areals Thomaskirchhof 16, denn hier siedelten Menschen schon in der Jungsteinzeit, wovon etwa 7500 Jahre alte Fundstücke zeugen.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.
18. Dezember 2010 bis 21. März 2011
Kann man die Bachblüte pflücken oder den Bachfisch fangen? Was wäre, wenn Bach sich als Bacchus verkleidet hätte und wie schnell ist die Bachschildkröte unterwegs? Etwa 50 Kinder und Jugendliche aus dem Leipziger KINDER-ATELIER hatten sich auf vielfältige Weise mit Johann Sebastian Bach beschäftigt und dabei eine Graphikserie voller Witz, Ironie und Vergnügen am Wortspiel geschaffen. Ergänzt wurden die kleinformatigen Arbeiten durch sechs große Bachbüsten, die aus ganz unterschiedlichen Materialien entstanden waren. Die Skulpturen aus Draht, Holz, Gasbeton oder Plastikflaschen waren nicht nur zum Betrachten gedacht, sondern konnten auf vielfältige und spielerische Weise genutzt werden, z.B. als Hörstationen oder Träger von Botschaften.
Entstanden war die Kabinettausstellung in Zusamenarbeit mit dem KINDER-ATELIER / KAOS, Trägerverein Kindervereinigung Leipzig e. V.
10. September bis 5. Dezember 2010
Wilhelm Friedemann Bach, der älteste Sohn Johann Sebastian Bachs, zählt zu den rätselhaftesten Figuren der Musikgeschichte. Sein Leben und Schaffen sind bis heute kaum angemessen erschlossen. Von Zeitgenossen wurde er als »der gründlichste Orgelspieler, größte Fugiste und tiefste Musikgelehrte Deutschlands« gerühmt, aber auch als der »etwas affektierte Elegant« charakterisiert. Die Ausstellung anlässlich seines 300. Geburtstages am 22. November 2010 begab sich auf die Spur des Musikers: Als Orgelvirtuose feierte Wilhelm Friedemann schon als junger Mann Triumphe. Mit Bravour absolvierte er sein Probespiel um die Organistenstelle der Dresdner Sophienkirche, und ohne Schwierigkeiten erlangte er das Amt des Musikdirektors der Hallenser Marktkirche, wo er über fast zwei Jahrzehnte seine anspruchsvollen Kantaten sowie zahlreiche Kompositionen seines Vaters darbot. 1764 fasste er den riskanten Entschluss, ein Leben als reisender Virtuose und freier Musiker zu führen, und kündigte seine feste Stelle in Halle. Ausgedehnte Konzertreisen führten ihn nach Braunschweig, Dresden und Wien, vermutlich sogar nach Sankt Petersburg und London. Sämtliche Versuche, wieder in feste Anstellung zu gelangen, scheiterten. Wilhelm Friedemann geriet in Armut und verstummte zuletzt auch als Komponist. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Berlin: alt, ausgelaugt und verbittert. Zu seinen Zeitgenossen ging er schon früh auf Distanz, wurde finster und abweisend und zog es immer mehr vor, im Verborgenen über musikalische Delikatessen zu grübeln. Auch heute erscheint uns seine Musik verschlossen, zuweilen gar unzugänglich.
Wer sich ihr und dem Komponisten nähern will, muss dies behutsam und mit Empathie tun, muss bereit sein, den kunstvollen Verschlingungen und der manchmal geradezu halsbrecherischen Virtuosität seiner Einfälle zu folgen, um dann eine Welt von schier unerschöpflicher Erfindungsgabe und verblüffendem melodischen Esprit zu entdecken. Mit Hilfe wertvoller Leihgaben aus ganz Deutschland zeichnete die Ausstellung Wilhelm Friedemanns Lebensweg nach und gab Einblicke in sein Werk und Wirken.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.
20. März bis 22. August 2010
Um eine »regulierte Kirchenmusik Gott zu Ehren« aufführen zu können, wechselte Bach im Jahr 1708 von Mühlhausen an den Weimarer Hof. Aber weder dort noch später in Köthen konnte er sich allein diesem erklärten »Endzweck« zuwenden. Erst als Bach im Jahr 1723 das Leipziger Thomaskantorat übernahm, rückte die Kirchenmusik in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Mit eindrucksvoller Selbstdisziplin schuf er nun vier Jahre lang nahezu wöchentlich eine neue Kantate für den Sonntagsgottesdienst, außerdem zwei große Passionsmusiken und prächtige lateinische Kirchenstücke – ein Repertoire, das an Kunstgehalt und Virtuosität alles zuvor in Leipzig Erklungene in den Schatten stellte.
Die erste Kabinettausstellung im neu eröffneten Bach-Museum bot einen Eindruck davon, wie Bach das ungeheuerliche Arbeitspensum bewältigte, welche Strategien er verfolgte, wer ihn bei dieser selbstgewählten »Mission« unterstützte und wie seine Kirchenmusik damals in Leipzig aufgenommen wurde.
Die Kabinettausstellung »Meisterwerke im Wochentakt« wurde u. a. mit Mitteln des Packard Humanities Institute (Los Altos, California) eingerichtet.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.